
DIE AUTOKRISE – WIRKLICH DIE GROSSE KRISE?
Ursachen und Auswege
Dreiteilige Vortragsreihe mit Dr. Hans-Christian Herrmann
Präsenz- & Online-Veranstaltung
Donnerstag, 20. März um 19:00 Uhr
Veranstaltungsort: Villa Lessing, Liberale Stiftung Saar
und live auf:
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter: veranstaltungen@villa-lessing.de
Alle reden von der Krise der deutschen Automobilindustrie und einer bevorstehenden Deindustrialisierung dieser wohl wichtigsten deutschen Branche. Die deutsche Krise ist aber auch eine europäische. Diesem Thema widmet sich eine dreiteilige Vortragsreihe, die das Thema aus einer neuen international vergleichenden Perspektive betrachtet und dabei zu interessanten Ansichten, anderen Ergebnissen und in Teilen ungewöhnlichen Empfehlungen zur Krisenbewältigung kommt.
Die Reihe startet mit einem Vortrag zum Niedergang der britischen, der Krise der Amerikanischen und dem Aufstieg der japanischen Autoindustrie mit Schwerpunkt auf den 1960er und 1970er Jahren. Dieser Blick zurück wird mit den aktuellen Entwicklungen gespiegelt und offenbart beachtliche Ähnlichkeiten zwischen der aktuellen deutschen Lage und dem sich Ende der 1960er Jahre abzeichnenden Untergang der Briten. Dabei wird deutlich, die deutsche Autokrise steht für das Ende des Geschäftsmodells der Bundesrepublik Deutschland nach 1945. Eine Entwicklung, die ab der Jahrtausendwende bereits begann und in einer Kultur des kurzfristigen Denkens ignoriert wurde.
Teil 2 der Vortragsreihe arbeitet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den einst großen Autonationen Frankreich, Italien einerseits und der langen deutschen Erfolgsgeschichte andererseits heraus. Dieser Vortrag legt falsch gesetzte staatlich Rahmenbedingungen und eine unkluge Steuerpolitik als wichtigen Grund für den von der Politik und Öffentlichkeit nicht wahrgenommenen Niedergang der europäischen Autoindustrie offen, von dem Deutschland verspätet betroffen wurde, auch weil sich seine Steuerpolitik von der seiner Partner in Rom und Paris unterschied.
Der abschließende dritte Vortrag widmet sich vor allem der politischen Entscheidung zur E-Mobilität in Europa. War sie im Grundsatz mit dem Verbrenner-Verbot ein Fehler oder wurde die Entscheidung nur gerade in Deutschland falsch umgesetzt? Dieser Frage widmet sich u. a. der dritte Teil der Vortragsreihe und vergleicht Entwicklungen in China, USA und Europa. Dabei wird auch deutlich, dass das Verhalten weiter Teile der europäischen Automobilindustrie mit Ausnahme von Volvo die Autobranche insgesamt zu einem für Politik und Gesellschaft wenig glaubwürdigen Partner machte. Diese Entwicklung begann bereits nach 1945 und zieht sich kontinuierlich wie ein roter Faden durch, die gefühlte Unglaubwürdigkeit bestätigte dann die Branche selbst mit dem Diesel-Skandal. Diese Konstellation beförderte politische Entscheidungen, die heute zumindest als fragewürdig bezeichnet werden dürfen und das E-Auto in Europa noch nicht auf der Überholspur fährt?
Teil 1: 20.03.2025
Deindustrialisierung in den 1970er Jahren. Der Untergang der britischen Automobilindustrie, das Ende der USA als automobiler Führungsmacht und der Siegeszug der Japaner
Die noch in den ersten Nachkriegsjahren auf Platz Eins in Europa stehende britische Automobilindustrie sollte binnen 15 Jahren zusammenbrechen. Viele erinnern sich noch an monatelange Streiks, aber sie waren letztlich nur Ausdruck eines Landes, das Reformen verpasst hatte und dessen Geschäftsgrundlagen wegbrachen ohne dass es die britische Gesellschaft wahrhaben wollte. Zum Zeitpunkt der Ölkrise 1973/74 war der Niedergang bereits nicht mehr aufzuhalten. Genau zu dieser Zeit drangen die Japaner auf allen Märkten vor, vor allem aber in den USA, weil sie eine Nachfrage bedienten, die die großen US-Autokonzerne nicht zu bedienen vermochten, aber angesichts explodierender Benzinpreise zum Thema Nr. Eins wurden. Bezahlbare Mobilität, also erschwinglich in der Anschaffung, zuverlässig und reparaturfreundlich bei niedrigem Verbrauch – diese Mobilitätsbedürfnisse standen in der Ölkrise bei den Amerikanern ganz oben und die Japaner erfüllten sie. Sie waren damals so wie es sich im Falle von China heute abzeichnet weltweit die Gewinner der Krise. Diese Entwicklung von damals eröffnet erstaunliche Parallelen zur aktuellen Situation der deutschen und europäischen Autobranche.
Teil 2: 10.04.25
Tolle Autos und keiner will sie? Zum Aufstieg und Niedergang der europäischen Automobilindustrie. Was „Superbollo“ und Protektionismus anrichten können.
VW, Fiat und Renault stehen für die deutsche, italienische und französische Automobilindustrie. In ihren Ländern symbolisieren sie die Geschichte des Wirtschaftswunders. Die drei Konzerne entwickelten sich bis zum EU-Binnenmarkt der 1990er Jahre ganz unterschiedlich, verantwortlich dafür auch unterschiedliche wirtschafts- und finanzpolitische Rahmenbedingungen. Protektionismus, nationales Denken und eine fragwürdige Fiskalpolitik Frankreichs und Italiens stehen für Fehlentwicklungen, die beide Autonationen ab den 1980er Jahren nachhaltig schwächen sollten. Dem steht das deutsche Modell entgegen: Mitbestimmung, Exportorientierung und eine gemäßigtere Steuerpolitik stärkten die deutschen Hersteller nachhaltig trotz wachsender asiatischer Konkurrenz. Frankreich und Italien konnten faszinierende Autos konstruieren, die Hersteller verdienten damit aber kein Geld und hatten außerhalb Europas keinen Erfolg.. Frankreich und Italien haben entscheidenden Anteil an der Entwicklung des modernen europäischen Automobils, andererseits orientiert sich die Nachfrage der Weltmärkte an anderen Formaten. Ein ab den 1990er Jahren beginnender Prozess, der zeigt, Europa bestimmte im Unterschied zum Zeitraum zwischen 1960 und 1980 nicht mehr die Entwicklungslinien des globalen Automobilbaus.
Aus dem Staatskonzern Renault ist eine Allianz mit den Japanern Mitsubishi und Nissan geworden und Fiat als Symbol der Industrialisierung Italiens zusammengeschrumpft im Stellantis-Konzern aufgegangen. Unbemerkt ist Italien schon seit 15 Jahren ein automobiler Zwerg. Auf Italien folgte der Niedergang der Franzosen. Die erfolgreiche Positionierung im Premiumsegment und die Pionierrolle von VW bei der Automobilisierung Chinas in Verbindung mit einer starken Stellung in den USA erklären die deutsche Sonderentwicklung. Bekommen diese Märkte Schnupfen, ist eine lebensbedrohliche Lungenentzündung unvermeidlich, weil der Markt in Europa strukturell kein ausreichend kompensierendes Wachstum ermöglicht. Erfolg macht arrogant, dabei hätte es Volkswagen aus seiner Geschichte mit dem Käfer besser wissen müssen. Der Vergleich offenbart, Protektionismus und die Idee vom Autofahrer als Melkkuh der Nation tragen zur Deindustrialisierung einer Branche bei – Italien und Frankreich beweisen dies.
Teil 3: 28.04.2025
„Voll daneben – Ziel erreicht oder Geisterfahrt?“ Was ist schiefgelaufen und wie kommt das E-Auto auf die Überholspur?
War die Entscheidung zur E-Mobilität bei gleichzeitigem Verbrenner-Verbot in Europa ein Fehler oder wurde die Entscheidung nur unklug umgesetzt? Dieser Frage widmet sich u. a. der dritte Teil der Vortragsreihe und vergleicht Entwicklungen in China, USA und Europa. Dabei werden klare Antworten entwickelt. Die von der Autobranche selbst verspielte Vertrauenswürdigkeit und ihre im Grunde seit den 1950er Jahren gepflegte Unwilligkeit, zentrale Herausforderungen der Massenmotorisierung tatkräftig anzupacken, verhinderte an der Realität orientierte Entscheidungen der Politik.
Eine von der Politik zu konsequent und ambitioniert gesetzte Zeitschiene und eine völlig verfehlte europäische Steuerpolitik bei gleichzeitig vernachlässigter Lade-Infrastruktur zeichnen sich als Hauptfehler ab. Wirtschaft und Verbraucher werden überfordert. Dabei wird auch deutlich, dass die Krise des europäischen Automarktes nicht nur mit der Ausgestaltung des Transformationsprozesses zum E-Auto zusammenhängt, sondern dass die Politik dazu beigetragen hat, dass der europäische Markt für die Branche insgesamt zunehmend unattraktiv geworden ist. Das rächt sich gerade dann, wenn man von China unabhängig werden möchte und die USA Europa mit Schutzzöllen drangsaliert. Einerseits kann nur die EU mit ihrem gemeinsamen Markt das Überleben der in den einzelnen Ländern der EU bestehenden Automobilindustrie sichern, andererseits gibt es in Europa kein Bewusstsein für gemeinsame Interessen und eine sich daraus ergebende wirklich abgestimmte Politik. Das System ist dysfunktional und das ist schwerwiegend, denn eine Automobilindustrie im nationalen Maßstab kann in Europa gar nicht existieren.
Dr. Hans-Christian Herrmann
1964 in Saarbrücken geboren. Historiker, Saarbrücken. Dr. Hans-Christian Herrmann beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit der Geschichte des Automobils, seiner wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung, und hat dazu umfassend publiziert.

Video des Abends
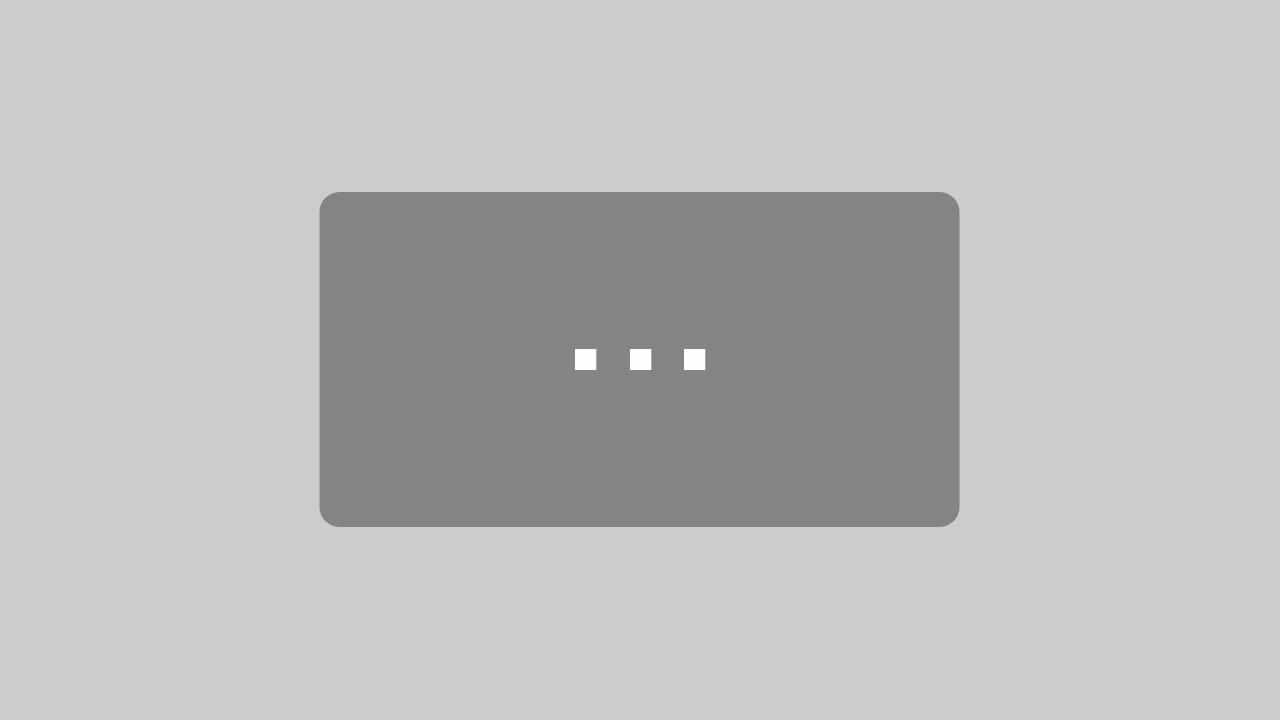
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Bilder des Abends









Veranstalter
Villa Lessing
Liberale Stiftung Saar
Veranstaltungsleitung
Hermann Simon
Geschäftsführer
Organisation
Daniela Frieg
Assistentin der Geschäftsleitung
Gäste
Der Villa Lessing Newsletter